Nun ist auf
Radio Prag das Interview von Gerald Schubert mit mir zu den Hausnummern in Tschechien erschienen, wer will, kann dort auch den Beitrag hören.
Ich habe nun meine Recherchen in Prag weitgehend abgeschlossen und konnte wenigstens ein paar interessante Informationen zum Prager Fragamt ausfindig machen. Die gesetzlichen Grundlagen dafür wurden mit dem Patent vom 4.9.1747 geschaffen, das die Gründung eines Versatzamts in Prag ankündigte.1 Vorbild für das Prager Patent war das entsprechende Patent für das Wiener Versatzamt von 1707, und so wurden auch die darin enthaltenen Bestimmungen zur Einrichtung eines Fragamts fast wortwörtlich übernommen, nur mit dem Unterschied, dass die Einschreibung des Anliegens in das Protokoll gegen Darreichung eines willkührlichen Allmosen-Geldes in die daselbst hangende Spar-Büchsen, wie er es begehret erfolgen sollte und nicht wie im Wiener Fall mit 17 Kreuzer festgelegt war. Es sollte allerdings bis 1750 dauern, bis ein gewisser Johann Lobstein vorschlug, das Fragamt einzurichten, das schließlich 1752 Joseph Ferdinand Bock übertragen wurde. Die ersten Kundschaftsblätter sollen übrigens noch in diesem Jahr erschienen sein, zumindest wird in den Akten einmal ein FragAmtsBlat sub N°8 dd° 4.Xbrus 1752 erwähnt;2 das früheste erhaltene Exemplar eines solchen Blatts scheint das einem Akt beiliegende vom 29.1.1753 zu sein, das ja bereits von Przedak abgedruckt wurde.3
An interessanten Materialien erhalten ist u.a. eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben für 1753, aus der hervorgeht, das von einer wöchentlichen Auflage von 350 Stück 96 bis 223 verkauft und nicht weniger als 57 Stück als Belegexemplare verteilt wurden. Auch eine Liste mit den Einschreibgebühren sowie einer kurzen Aufstellung der begehrten oder angebotenen Dinge oder Dienste ist für dieses Jahr vorhanden; daraus geht hervor, dass die Einschreibgebühr 6 Kreuzer betrug.4
Interessant ist dann auch noch ein Verbesserungsvorschlag durch den Buchdrucker Ignatz Franz Pruscha, der das Fragamt ab 1757 innehatte. Darin möchte er das Fragamt mehr als bisher für die Vermittlung von Dienstbotinnen und Dienstboten einsetzen, geradezu zu einem regelrechten Dienstbotenamt ausbauen sowie Transportdienste vermitteln.5
(1) Narodní Archiv (NA), Patenty, 1747 záři 4
(2) NA, ČG-Publ. 1748-1755, O 3, Kt.130, Aktennotiz, 19.1.1763
(3) NA, ČG-Publ. 1748-1755, O 3, Kt.130, In Königreich Böheim. Wochentliche Frag- und Anzeigs-Nachrichten, 29.1.1753; PRZEDAK, A[dolar]. G[uido].: Das Prager Intelligenzblatt. Kulturgeschichtliche Bilder aus dem alten Prag. Prag: Statthalterei-Buchdruckerei, 1918, S.30-39.
(4) NA, ČG-Publ. 1748-1755, O 3, Kt.130, „Berechnung Über den a 1ma Aprilis Anno 1753 intuito des Neuerrichteten Frag-Ambts für die gewöhnl: Wochenblätter a Nro 13 bis ad Nro 52 inclusive dann an Einschreibgebühnüssen, Eingekommenen Geld Empfang, und respective Ausgaab“, undatiert.
(5) NA, ČG-Publ. 1756-1763, N 3, Kt.215, Verbesserungsvorschlag von Pruscha, undatiert
adresscomptoir -
Adressbueros - Sa, 8. Dez. 2007, 09:00
Wie die
UZ sowie das
Deutschlandradio berichten, zeigt das Düsseldorfer
Heinrich-Heine-Institut (Bilker Str. 12-14, 40213 Düsseldorf) noch bis 24.2.2008 Aquarelle von Alfred Hrdlicka zu Heinrich Heine.
Könnte sich sogar gut ausgehen, dass ich mir diese anschauen kann, da ich im Jänner zur Tagung
Jüdische Migration und Mobilität in der Frühen Neuzeit fahre.
adresscomptoir -
Kunst - Fr, 7. Dez. 2007, 22:59
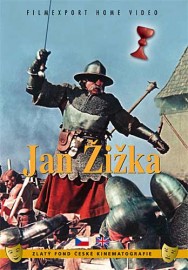
So ein Aufenthalt in Tschechien ist mal auch wieder eine Gelegenheit, meine Devotionaliensammlung zu den geschätzten Hussiten zu vervollständigen. Die Hussitenfilmtrilogie aus den 50er-Jahren konnte ich ja schon im Februar in Brno auf DVD erstehen (es handelt sich dabei um: 1. Jan Hus 2. Jan Žižka 3. Proti všem, alle mit englischen Untertiteln, vgl.
hier), nun konnte ich auch den 1947 gedrehten Film
Jan Roháč z Dubé auf DVD bekommen; das Denkmal für besagten Roháč im Hvězda-Areal in Prag habe ich auch schon besichtigt.
Mit hussitischer Musik ist es allerdings nicht ganz so einfach, dabei wären doch ein paar hussitische Schlachtgesänge auf CD doch ein Renner, nicht wahr? Immerhin,
Ktož jsú boží bojovníci (Die ihr Gottes Streiter seid) gibt es
hier in verschiedenen Versionen als MP3; was aber ist mit
Povstaň, povstaň, veliké město Pražské (Auf, auf du große Stadt Prag)? Und was ist mit dem
Jistebnický kancionál, einem Liederbuch der Hussiten? Es gibt davon eine 2005 erschienene kritische Ausgabe, aber kaum Vertonungen auf CD.
Erfreulicherweise gibt es mittlerweile aber zwei neuere CD-ROMs zu den Hussiten; beide (nämlich: Husitství a literatura, Media Works 2003 sowie: Encyclopedie husitství, Media Works 2007) sind im Museumsshop des
Hussitenmuseum in Tabor zu kaufen.
Nachtrag: Auf der CD-ROM
Husitství a literatura gibt es eine WAV-Version von
Povstaň, povstaň, veliké město Pražské.
adresscomptoir -
Widerstaende - Fr, 7. Dez. 2007, 09:00
Erfreulicherweise klappte es recht problemlos, die Mikrofiches mit ein paar Jahrgängen des Prager Kundschaftsblattes von der
Bibliothek der Fakulta sociálních věd der Karlsuniversität an die Prager Nationalbibliothek zu transferieren, und mittlerweile habe ich sie mir auch schon durchgesehen. Folgende Jahrgänge - und damit mehr als bei Laiske angegeben - waren dort vorhanden: 1754, 1755, 1757-1769 (einzelne Nummern fehlen, insbesondere bei den Jahrgängen 1762 und 1769). Sehr ergiebig war das ganze nicht, aber es ist halt eine notwendige Arbeit. Ich hoffe auch, dass ich demnächst herausbekomme, an wen die Originalbände restituiert wurden.
Im übrigen habe ich auch einen Ausflug zum Hauptsitz des Prager
Narodní Archiv gemacht, der sich im am Prager Stadtrand gelegenen Chodovec befindet. Die Bibliothek dort ist ziemlich beeindruckend, in den verschiedenen Katalogen konnte ich allerdings keine Exemplare des Kundschaftsblatts ausfindig machen.
adresscomptoir -
Adressbueros - Do, 6. Dez. 2007, 09:00
Feines Programm, das Franz Fillafer und Romana Filzmoser da zusammengestellt haben: Die Tagung
Befürchtungen des 18. Jahrhunderts findet am 14./15.12.2007 in Wien am IFK (Reichsratsstraße 17) statt, u.a. sind folgende Vorträge angekündigt:
Michael Gamper: Innere Karibik. Die Menschenmasse als das Andere zivilisatorischer Ordnung
Eva Kernbauer: Multitude, oder: Die Unmöglichkeit der Aufklärung
Franz Leander Fillafer: Das Fürchten lernen in des „sittlichen Bürgers Abendschule“
Peter J. Bräunlein: Furchterregende Randzonen der Aufklärung: Skandalon Vampirismus
Jeffrey Freedman: Die Grenzen der Toleranz. Die Aufklärung, die Juden und die Furcht vor einem frühzeitigen Begräbnis
adresscomptoir -
Veranstaltungen - Mi, 5. Dez. 2007, 09:00
Es sind die kleinen Unterschiede, die's ausmachen: Obwohl in den böhmischen und österreichischen Ländern 1777, also sieben Jahre nach der Hausnummerierung, die Türnummern als so genannte "Familiennummern" eingeführt wurden gibt es heute wichtige Unterschiede in ihrer Verwendung: In Wien kennt jeder seine Türnummer, sie sind zumeist an den Türen angeschrieben und werden für die postalische Adressierung verwendet. In Prag ist das anders: Gerald Schubert von Radio Prag, der letzte Woche mit mir ein Hausnummern-Interview führte, erzählte mir, dass es zwar in Prag auch theoretisch Türnummern gibt, diese aber im Alltag keine Bedeutung haben. Probleme gibt's nur, wenn bestimmte Behörden, z.B. die Stadtwerke, die Angabe der Türnummer in irgendwelchen Formularen verlangen. Dann ist umständliches Nachforschen nötig, welche Türnummer man denn habe, denn auch die Vermieter kennen diese nicht. Dafür wiederum wird oft bei alltäglichen Adressenangaben die popisné číslo, also die Konskriptionsnummer zusätzlich zur straßenweisen Orientierungsnummer angegeben.
-Hm, das wäre doch Anlass genug für eine Onlineumfrage: Wie sieht's in Eurer/Ihrer Stadt aus? Gibt's dort Türnummern? Kommentare und Erlebnisberichte auch aus bereisten Städten sind willkommen!
adresscomptoir -
Nummerierung - Di, 4. Dez. 2007, 09:00
In einer Woche sollte ich wieder in Wien sein, und da findet nun endgültig mein Vortrag beim
Jour Fixe Kulturwissenschaften der Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte auf der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt.
Titel: Informationsvermittlung in der Frühen Neuzeit: Théophraste Renaudot und das „Bureau d’Adresse“ [
Abstract (PDF)]
(Aber versprochen: Am Anfang wird's auch ein bisschen über offene Fragen der Hausnummernforschung gehen!)
Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Hauptgebäude, Dr. Ignaz Seipel–Platz 2, 2. Stock, 1010 Wien
Zeit: Mo 10.12.2007, 15 Uhr
adresscomptoir -
Adressbueros - Mo, 3. Dez. 2007, 09:00

Viel historische Hausnummern habe ich in der geschätzten Stadt Tabor nicht ausfindig machen können, immerhin aber diesen Überrest einer Nummer 118 in der Koželužská.
adresscomptoir -
Fotos - So, 2. Dez. 2007, 09:00
Und gleich noch eine Buchpräsentation in der Wiener Hauptbücherei (5.12.2007, 19 Uhr), diesmal zum Gürtel, der, bevor er zur Verkehrshölle wurde, als
RIngstraße des Proletariats galt (Vgl. übrigens auch
hier). Aus der
Ankündigung:
Moderation: Andreas Kreiner
Der Wiener Gürtel: Ein Ort, der in der Vorstellung nicht nur vieler Wiener mit Verkehrschaos, Lärm, Schmutz, Verfall und Rotlichtmilieu assoziiert wird. Denn am Gürtel, so ein verbreitetes Vorurteil, leben nur jene, die keine andere Wahl haben.
Der Gürtel war und ist jedoch mehr ist als eine innerstädtische Rennstrecke, an der heute so viele Menschen leben wie in Klagenfurt. Nicole Süssenbek und Tina Gerstenmayer unternahmen für ihr Buch Der Gürtel. Definitionen einer Veränderung Streifzüge durch Geschichte und Gegenwart dieses urbanen Siedlungsraumes. Sie begegneten dabei manchen Überraschungen, sie lassen Menschen zu Wort kommen, deren Leben mit dem Gürtel verknüpft ist - und sie machen deutlich, dass der Wiener Gürtel keineswegs eine Gegend ist, die ihre Zukunft bereits hinter sich hat. Sondern dass er ein Ort mit Lebensqualität sein kann, wenn seine Bewohnerinnen und Bewohner aktiv an seiner Gestaltung und Veränderung mitwirken.
Süssenbek, Nicole/Gerstenmayer, Tina: Der Gürtel. Definition einer Veränderung. Wien: Verein Memo, 2007.
adresscomptoir -
Veranstaltungen - Sa, 1. Dez. 2007, 09:00
Am Dienstag, 4.12.2007 wird ab 19 Uhr in der Wiener Hauptbücherei am Gürtel (Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien) Natascha Vittorellis Buch
Frauenbewegung um 1900. Über Triest nach Zagreb (Wien: Löcker, 2007) in der Reihe
Pro und contra - Aktuelle Sachbücher im Gespräch präsentiert.
Aus der Veranstaltungsankündigung:
Podiumsdiskussion mit Natascha Vittorelli, Vlatka Frketić (diskursiv - verein zur verqueerung gesellschaftlicher zusammenhänge), Eva Geber (AUF - eine Frauenzeitschrift)
Moderation: Ina Freudenschuss (die Standard.at)
Um die Frauenbewegung scheint es auffallend still geworden zu sein. Seit den 1970er Jahren, vor allem aber seit 1900 hat sich die Situation von Frauen nachhaltig verbessert: Erfolge wie das Frauenwahlrecht, das Recht auf Bildung und Ausbildung, die Fristenlösung usw. haben Aussehen und Anliegen der Frauenbewegung ebenso transformiert wie gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Zwischen Vergangenheit und Zukunft - gibt es derzeit eine Frauenbewegung?
Ein Gespräch über aktuelle Problematiken, unerledigte Anliegen und darüber, was Frauenbewegung war, ist und sein könnte.adresscomptoir -
Gender - Fr, 30. Nov. 2007, 09:00
Auf den
hier angezeigten Artikel Oliver Hochadels in der
Berner Zeitung gab es eine Reaktion, die auf wichtige Präzisierungen zu einer der bekanntesten Hausnummer, nämlich
Köln 4711 hinweist. Die entsprechende Info stammt vom
Stadtarchiv Köln:
Hausnummern in Köln
Woher stammt bzw. wie entstand die Hausnummer 4711?
Die Stadt Köln hat bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. mehrmals den Versuch unternommen, Hausnummern einzuführen. Eine erste Hausnummerierung kam während der Einquartierung französischer Truppen im Siebenjährigen Krieg zustande. Nach einer Kostenaufstellung von 1760/61 hatte die Stadt 5300 Blechschilder zur Nummerierung der Häuser anfertigen lassen.[ 1 ] Die Häuser waren jeweils in den acht mit A - H bezeichneten Kolonelschaften, in die die Stadt seit 1583 eingeteilt war, durchnummeriert. Dies zeigen Urteile des städtischen Fiskalgerichts aus den Jahren 1767-1784, durch die leerstehende Häusern der Stadt übereignet worden sind, so z.B. Buschgasse Nr. 178, Kattenbug Nr. 629, Kostgasse Nr. 697, Unter Pöster (Auf dem Ufer) Litera D Nr. 80, Schaafenstraße Nr. 746 und 747, Weidengasse Nr. 33.[ 2 ] Noch am 19. Juli 1794 wurde das Haus Kostgasse Nr. 697 im Schreinsbuch eingetragen.[ 3 ] Im Jahre 1782 beschloß der Rat erneut eine Häusernummerierung, mit deren Durchführung die Wachtkommission beauftragt wurde. [ 4 ] Sie wies darauf hin, daß eine solche Maßnahme selbst für „kleine Flecken“, namentlich aber für große Städte nützlich sei, und schlug vor, die Bürger sollten die Nummern mit Ölfarbe an die Häuser malen. Wiederum sollten die Häuser nach den Kolonelschaften durchgezählt werden. Unsicher ist, ob diese Nummerierung ausgeführt wurde. Die Wachtkommission hat jedoch seit 1784 für ihre Rechnungsbücher sämtliche Häuser einer Fahne, der Unterabteilung der Kolonelschaft, durchnummeriert und dabei auch die geistlichen und der leerstehenden Häuser berücksichtigt.[ 5 ] Eine Bürgerbestandsaufnahme, mit der am 16. Februar 1789 die Mittwochsrentkammer beauftragt wurde,[ 6 ] sollte die Grundlage für einen weiteren Versuch bilden, der wohl auch erfolglos blieb. Erst als die Franzosen 1794 kurz vor Köln standen, sah der Rat höchste Eile geboten. Drei Tage vor dem Einmarsch schlug die Wachtkommission am 3. Oktober 1794 vor, die gebotenen Gegenmaßnahmen auf der Grundlage der Häusernummerierung zu organisieren.[ 7 ] Der Auftrag an die Wachtkommission erfolgte am 7. Oktober.[ 8 ] Sie legte bei der alsbaldigen Durchführung ihre ältere fahnenweise Nummerierung zugrunde, zählte jetzt aber sämtliche Häuser der Stadt in der Reihenfolge der Kolonelschaften durch. Am 20. Oktober notierte der Ratsverwandte Gottfried von Gall in seinem Tagebuch, daß man mit der vor acht Tagen begonnenen Nummerierung und Litterierung der Häuser fortfahre,[ 9 ] und Heinrich Joseph Metternich, der Verleger des ältesten Kölner Adressbuches von 1795, spricht in seiner am 1. Dezember 1794 vom Rat behandelten Eingabe[ 10 ] davon, die Nummerierung sei inzwischen erfolgt. Das Haus in der Glockengasse, damals im Besitz der Witwe des Wilhelm von Lemmen, erhielt die Nummer 4711.[ 11 ] Erst im Adreßbuch von 1797 wird Wilhelm Mülhens als Eigentümer genannt. Als Berufsbezeichnung ist angegeben: „in Speculationsgeschaeften“; unter den Herstellern von Kölnisch Wasser wird er noch nicht aufgeführt. Die fortlaufende Nummerierung wurde 1811 auf eine straßenweise Nummerierung umgestellt. Im Vorwort des ersten danach erschienenen Adressbuches von 1813 behauptet der Verleger Thiriart, vor Ankunft der Franzosen habe es in Köln keine Hausnummerierung gegeben. Hier beginnt die Legendenbildung.
[ 1 ] HAStK, Best. 33 (Militaria) Siebenjähriger Krieg, X 4, Bl. 198.
[ 2 ] HAStK, Bestand 30 (Verf. u. Verw.), N 1374, Bl. 34, 40, 52, 59-66, 71, 85-90.
[ 3 ] HAStK, Bestand 101 (Schreinsbücher) Nr. 431, Bl. 56r.
[ 4 ] HAStK, Bestand 10 (Ratsprotokolle) Nr. 229, Bl. 91 und 168v-169r.
[ 5 ] HAStK, Bestand 70 (Rechnungen) Nr. 1348-1353, 1353A, 1355-1359; Bestand 30 (Verf.u.Verw.) N 673.
[ 6 ] HAStK, Bestand 70 (Rechnungen) Nr. 139, Blatt 56r.
[ 7 ] HAStK, Bestand 10 (Ratsprotokolle) Nr. 241 Bl. 216v.
[ 8 ] HAStK, Bestand 10 (Ratsprotokolle) Nr. 241 Bl. 225r.
[ 9 ] HAStK, Bestand 7030 (Chron.u.Darst.) Nr. 175 Bl. 71v.
[ 10 ] HAStK, Bestand 350 (Franz. Verw.) Nr. 306, Blatt 3-6.
[ 11 ] Adresse-Kalender der Stadt Köln, 1795.adresscomptoir -
Hausnummerierung - Do, 29. Nov. 2007, 09:00
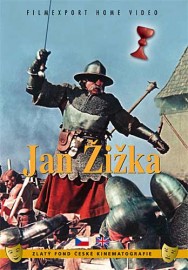 So ein Aufenthalt in Tschechien ist mal auch wieder eine Gelegenheit, meine Devotionaliensammlung zu den geschätzten Hussiten zu vervollständigen. Die Hussitenfilmtrilogie aus den 50er-Jahren konnte ich ja schon im Februar in Brno auf DVD erstehen (es handelt sich dabei um: 1. Jan Hus 2. Jan Žižka 3. Proti všem, alle mit englischen Untertiteln, vgl. hier), nun konnte ich auch den 1947 gedrehten Film Jan Roháč z Dubé auf DVD bekommen; das Denkmal für besagten Roháč im Hvězda-Areal in Prag habe ich auch schon besichtigt.
So ein Aufenthalt in Tschechien ist mal auch wieder eine Gelegenheit, meine Devotionaliensammlung zu den geschätzten Hussiten zu vervollständigen. Die Hussitenfilmtrilogie aus den 50er-Jahren konnte ich ja schon im Februar in Brno auf DVD erstehen (es handelt sich dabei um: 1. Jan Hus 2. Jan Žižka 3. Proti všem, alle mit englischen Untertiteln, vgl. hier), nun konnte ich auch den 1947 gedrehten Film Jan Roháč z Dubé auf DVD bekommen; das Denkmal für besagten Roháč im Hvězda-Areal in Prag habe ich auch schon besichtigt.