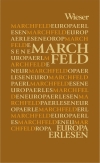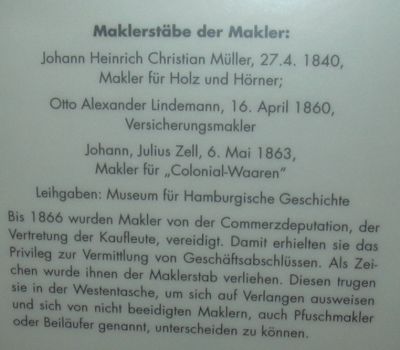Projekt eines Adress- und Botschaftscomptoirs von Christian Troye, Altona 1767
35 Jahre nach Rudolph Georg Fochts vergeblichem Bemühen, in Altona ein Adresscomptoir einzurichten, wird wieder ein ähnliches Projekt vorgeschlagen, das die Dienste einer Stadtpost mit einem Annoncenblatt vereinen will. Diesmal ist es der aus Janau nach Altona gezogene Christian Troye, der 1767 um ein Privileg für ein Addresh- und BotschaftsComtoir ansucht; er möchte der Altonaer Kaufmannschaft, zumal bei schlechter Witterung, den Gang nach der Hamburger Börse zur Abholung der Post ersparen, weswegen er eine Botschaft zwischen Hamburg und Altona einrichten möchte. Dies hätte auch den Vorteil, dass nicht länger unentbehrliche Dienstboten oder eigene Arbeitsleute dazu herangezogen werden müssten, die Post zu besorgen; für jeden Brief wäre ein Schilling Porto zu bezahlen. [O]hnzertrenlich damit verknüpft solle das Adresscomptoir sein, durch welches all iner Angelegenheiten, sie haben Nahmen, wie sie wollen, unter einander am leichtesten bekandt gemacht werden [könnten], wie auch ankommende Fremde, dadurch Gelegenheit fänden, ihre Dienste der Stadt, ohne langes Nachsuchen, sogleich erkennen geben zu können. Das Intelligenzblatt, das Troye begründen möchte, trägt den Namen Königlich privilegirte Altonaische Frag- undt Anzeigungen, ein handschriftlicher Entwurf dazu liegt dem Gesuch bei, er enthält Nachrichten über Waren, die zu verkaufen oder kaufen gesucht sind, Stellenanzeigen, Angebote zu vermietender Häuser, Verlust- und Fundmeldungen, Berichte über an- und abfahrende Schiffe, Getreidepreise, Währungskurse und Tauf- Trauungs- und Sterbemeldungen. Der Gedanke dazu sei eintzig aus einem redlich bürgerlichen Hertzen entsprungen. In einem weiteren Schreiben unterstreicht Troye die Nützlichkeit insbesondere der Stellenanzeigen: Die dientsuchenden Fremden seien die Addresh-Häuser von auswärts her gewohnt, ohne die sie lange und ihre Ersparnisse verzehrend sich in Wirtshäusern einquartieren müssten; wenn sie bei der Stellensuche scheiterten, müssten sie betrübt, ja schier nackend wieder von dannen weichen und würden vielleicht StraßenRäuber werden. Der Rat der Stadt Altona spricht sich gegen Troyes Gesuch aus; was das Adresscomptoir betreffe, so sei es lächerlich, Tauf-, Trau- und Sterbefälle auf die geplante Weise publik zu machen; Auktionen öffentlich anzukündigen, sei zwar vielleicht nützlich, aber nicht wirklich notwendig, da kleine Auktionen ohnehin durch öffentliche Ausrufer und Privat-Notificationen bekannt gemacht werden und größere Auktionen in den schon bestehenden öffentlichen Zeitungen angekündigt werden. Die Versteigerung von Liegenschaften wiederum werde von der Kanzel und durch Anschläge an die KirchenThüren verkündigt. Weiters bezweifelt der Rat, dass Troye fähig wäre, sein Intelligenzblatt mit genügend Nachrichten zu füllen; bekäme er ein ausschließliches Privileg, würde ein anderer, Fähigerer in Zukunft daran gehindert, ein solches Blatt herauszugeben. Was das Botschaftscomptoir betrifft, so weiss der Rat zwar darum, dass ein solches von der hiesigen Kaufmannschaft bereits öfters bedacht wurde, hat aber den Einwand, dass Troye nicht fähig ist, eine Kaution dafür zu hinterlegen. Die deutsche Kanzlei in Kopenhagen schliesst sich dieser ablehnenden Stellungnahme an, das Projekt wird ad acta gelegt.
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, Abt. 65.2 Nr. 685 I: Gesuch Troye an dänischen König, pr. 4.6.1767; Beilage Lit.A: Entwurf Altonaische Frag- undt Anzeigungen; Schreiben Troye an den Rat der Stadt Altona, 23.7.1767; Schreiben Troye an Geheimrat Göhler, 8.9.1767; Rat der Stadt Altona an Conferenzrat und Oberpräsident Göhler, 31.8.1767; Bescheid der Deutschen Kanzlei an Christian Troye, Kopenhagen 3.10.1767.
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, Abt. 65.2 Nr. 685 I: Gesuch Troye an dänischen König, pr. 4.6.1767; Beilage Lit.A: Entwurf Altonaische Frag- undt Anzeigungen; Schreiben Troye an den Rat der Stadt Altona, 23.7.1767; Schreiben Troye an Geheimrat Göhler, 8.9.1767; Rat der Stadt Altona an Conferenzrat und Oberpräsident Göhler, 31.8.1767; Bescheid der Deutschen Kanzlei an Christian Troye, Kopenhagen 3.10.1767.
adresscomptoir -
Adressbueros - So, 22. Jan. 2006, 13:20