Foucaults Hausnummer

Paris, 15. arrondissement: 285, rue de Vaugirard: Das Haus, in dem Michel Foucault wohnte.
Coming soon: Adornos und Horkheimers Hausnummern!
adresscomptoir -
Fotos - Mo, 10. Apr. 2006, 09:36

 Der Einsiedlerpark wurde in den Jahren 1883 und 1884 in zwei Etappen angelegt: Im ersten Jahr wurde nur der Abschnitt zwischen Einsiedler- und Embelgasse bepflanzt und erst im folgenden Jahr, nachdem die Gemeinde Wien das restliche Grundstück angekauft hatte, konnte auch der Teil zwischen Embelgasse und Obere Amtshausgasse in einen Park umgestaltet werden. Aus einem wenige Jahre zuvor entstandenen Plan geht hervor, daß es ursprünglich beabsichtigt war, auf dem Einsiedlerplatz eine Kirche zu errichten.
Der Einsiedlerpark wurde in den Jahren 1883 und 1884 in zwei Etappen angelegt: Im ersten Jahr wurde nur der Abschnitt zwischen Einsiedler- und Embelgasse bepflanzt und erst im folgenden Jahr, nachdem die Gemeinde Wien das restliche Grundstück angekauft hatte, konnte auch der Teil zwischen Embelgasse und Obere Amtshausgasse in einen Park umgestaltet werden. Aus einem wenige Jahre zuvor entstandenen Plan geht hervor, daß es ursprünglich beabsichtigt war, auf dem Einsiedlerplatz eine Kirche zu errichten. Der zur Schule gehörende Abschnitt war vom dritten Teil des Parks durch eine Planke abgetrennt; er umfaßte einen Sommerturnplatz und zwei getrennte Schulgärten, einer für die Buben, einer für die Mädchen. Dort wurden schon in den ersten Jahren des Bestehens der Schule landwirtschaftliche Kulturpflanzen angebaut; bei einer kleinen Ausstellung, die von der Knabenhauptschule im Jahr 1935 veranstaltet wurde, konnten die Besucherinnen und Besucher ein Alpinum – also eine kleine Anlage mit Gebirgspflanzen –, ein von den Schülern verfertigtes Glashaus und eine Wetterbeobachtungsstelle bewundern.
Der zur Schule gehörende Abschnitt war vom dritten Teil des Parks durch eine Planke abgetrennt; er umfaßte einen Sommerturnplatz und zwei getrennte Schulgärten, einer für die Buben, einer für die Mädchen. Dort wurden schon in den ersten Jahren des Bestehens der Schule landwirtschaftliche Kulturpflanzen angebaut; bei einer kleinen Ausstellung, die von der Knabenhauptschule im Jahr 1935 veranstaltet wurde, konnten die Besucherinnen und Besucher ein Alpinum – also eine kleine Anlage mit Gebirgspflanzen –, ein von den Schülern verfertigtes Glashaus und eine Wetterbeobachtungsstelle bewundern.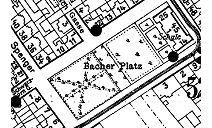 Die ersten Bäume am Bacherplatz – er wurde 1871 nach dem vermutlich zwei Jahre zuvor verstorbenen Gärtner und Armenrat Leopold Bacher benannt, dem manche der dort befindlichen Grundstücke gehörten – wurden in den Jahren 1877 – 1879 gepflanzt. In den Jahren darauf wurde der Park angelegt; als er 1884 vollendet wurde, gab es dort schon einen Kinderspielplatz, Hydranten und zwanzig Sitzbänke. Letztere waren in der Regel kleiner als die heutigen, und ihre Zahl wurde permanent erhöht: 1893 waren im Bacherpark schon siebzig Bänke aufgestellt.
Die ersten Bäume am Bacherplatz – er wurde 1871 nach dem vermutlich zwei Jahre zuvor verstorbenen Gärtner und Armenrat Leopold Bacher benannt, dem manche der dort befindlichen Grundstücke gehörten – wurden in den Jahren 1877 – 1879 gepflanzt. In den Jahren darauf wurde der Park angelegt; als er 1884 vollendet wurde, gab es dort schon einen Kinderspielplatz, Hydranten und zwanzig Sitzbänke. Letztere waren in der Regel kleiner als die heutigen, und ihre Zahl wurde permanent erhöht: 1893 waren im Bacherpark schon siebzig Bänke aufgestellt.