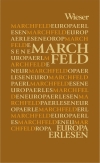Eine wichtige Veröffentlichung zum Prager Fragamt, allerdings nicht leicht greifbar, da weder in deutschen noch in österreichischen Bibliotheken ausfindig zu machen; ich bekam ein Exemplar per Fernleihe aus der Moravská zemská knihovna in Brno:
PRZEDAK, A[dolar]. G[uido].: Das Prager Intelligenzblatt. Kulturgeschichtliche Bilder aus dem alten Prag. Prag: Statthalterei-Buchdruckerei, 1918.
Przedak benutzt in diesem Büchlein - leider ohne genau zu zitieren - auch Quellen aus Prager Archiven.
adresscomptoir -
Adressbueros - Do, 19. Jul. 2007, 07:54
Nun ist auch auf
kakanien.ac.at eine Präsentation meines Adressbüro-Projekts erschienen, die sich vor allem auf die habsburgischen Frag- und Kundschaftsämter konzentriert.
#FragamtWien
adresscomptoir -
Adressbueros - So, 17. Jun. 2007, 12:46
In der
Universitätszeitung ist gestern ein Beitrag von mir erschienen, in dem ich mein FWF-Projekt zu den Adressbüros in der Frühen Neuzeit vorstelle; im Juni soll dann eine weitere Präsentation auf
Kakanien erfolgen, die mehr auf die Verhältnisse in der Habsburgermonarchie zugeschnitten ist.
adresscomptoir -
Adressbueros - Fr, 25. Mai. 2007, 08:45
Heute bin ich mit meinem Vortrag dran auf der Tagung Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburgermonarchie.
Mein Abstract lautet wie folgt:
Immer verworrener, unübersichtlicher und chaotischer werden die Städte in der Frühen Neuzeit; es bedarf einer Reihe von aufwändigen Maßnahmen und Einrichtungen, um sie für ihre BewohnerInnen und für fremde BesucherInnen benützbar zu machen. Eine dieser Einrichtungen sind die seit dem 17. Jahrhundert gegründeten Adressbüros. Das berühmteste unter ihnen ist das von Théophraste Renaudot in Paris eingerichtete Bureau d’adresse, das ab 1630 existierte; in London wiederum leitete 1650 Henry Robinson ein kurzlebiges Office of Address for Accomodations, und es wurden in der Folge eine Reihe so genannter Registry Offices installiert, worunter vor allem das von Henry Fielding 1750 begründete Universal Register Office hervorzuheben ist. Auch in deutschsprachigen Städten gibt es solche Einrichtungen, so wurde in Berlin 1689 ein Adress-Hauß eingerichtet. Alle diese Büros verwalten und makeln Informationen und Adressen, verweisen auf neu erschienene Bücher und vermitteln Mitfahrgelegenheiten bei Reisen; sie treten neben die traditionellen Beziehungsnetzwerke und übernahmen manche deren Funktionen, wie zum Beispiel Verkaufs- und Arbeitsvermittlung, Informationsaustausch, Kreditvergabe oder Botendienste.
Mein Beitrag soll sich mit den Adressbüros in der Habsburgermonarchie beschäftigen; gegründet wurden sie - nach einem ergebnislos verlaufenen Versuch des baskischen Sprachlehrers Johannes Angelus de Sumaran, 1636 eine offentliche fragstuben einzurichten - durchgehend im Laufe des 18. Jahrhunderts. In Wien war es 1707 soweit, damals wurde gleichzeitig mit dem Versatzamt - dem heutigen Dorotheum - das Frag- und Kundschaftsamt gegründet, eine Einrichtung, über die sehr wenig bekannt ist. Sicher ist, dass es über Jahrzehnte hindurch existierte und ab den 1720er Jahren eng mit dem Wienerischen Diarium kooperierte; es gab bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein eigenes Anzeigenblatt - die Post-tägliche Wiener Frag- und Anzeigungs-Nachrichten, auch Kundschaftsblatt genannt - heraus, in dem neben Verkaufsanzeigen u.a. Stellenanzeigen, Steckbriefe sowie Verweise auf neu erschienene Bücher abgedruckt wurden.
Auch in Prag gab es ein Fragamt; es wurde 1747 in Zusammenhang mit dem dortigen Versatzamt gegründet und gab wie das Wiener Amt ein Kundschaftsblatt heraus. In Brünn wiederum wurde eine solche Einrichtung 1751 gegründet; es sollte ein Informationszentrum sein, in dem man u. a. Auskunft über den Postverkehr und Fracht- und Maut-Gebühren holen konnte. In Klagenfurt scheiterte 1757 das Projekt, ein Fragamt einzurichten, auch eine vergleichbare Einrichtung in Innsbruck blieb nur Projekt. Sehr wohl gegründet wurde aber ein Fragamt in Budapest, angesiedelt im „Schustermajers Hause auf dem Servitenplaz“.
Ziel meines Beitrags ist es, auf Grundlage von archivalischen sowie gedruckten Quellen einen ersten Überblick über diese in Vergessenheit geratenen Institutionen zu liefern.
#FragamtWien
adresscomptoir -
Adressbueros - Sa, 28. Apr. 2007, 09:00
Nachdem ich letztes Jahr in der Wienbibliothek 26 Bände (nämlich 1728 und 1730-1754) der Veröffentlichung des Wiener Frag- und Kundschaftsamtes durchgegangen bin (vgl.
hier und
hier) bin ich nun dank ORBI, der Österreichischen Retrospektiven Bibliographie daraufgekommen, dass doch noch mehr Jahrgänge dieser Publikation erhalten sind; die letzten beiden Bände, für die Jahre 1812 und 1813, habe ich mir auch schon angesehen, wirklich ergiebig sind sie nicht, aber es hilft wohl nichts, ich werde die restlichen 34 Bände wohl noch dieses Jahr durchschauen. Der genaue Titel der Publikation lautete in den letzten Jahren übrigens
Posttägliche Anzeigen aus dem k.k. Frag- und Kundschaftamte zu Wien.
Folgende Jahrgänge gibt es in der Wienbibliothek: 1728, 1730-1754; 1763-1765, 1779; 1794-1805; 1807; 1809-1813 (Signatur F 19.111, jeweils Beiband).
Weiters sind in der Österreichischen Nationalbibliothek noch erhalten: 1772-1775; 1780-1783; 1785-1788 (Signatur 1,005.524-D, beigebunden); sowie: 1794-1799 (Signatur 393.052-D.Alt, beigebunden).
LANG, Helmut W. (Hg.): Österreichische Retrospektive Bibliographie (ORBI). Reihe 3: Österreichische Zeitschriften 1704-1945. München: Saur, 2006, Bd.1, S.414-416, 437f (=Nr.3,1:686-689, 731)
#FragamtWien
adresscomptoir -
Adressbueros - Mi, 28. Mär. 2007, 10:17
Nun habe ich die gute Nachricht auch auf Papier bestätigt: Der
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) - das österreichische Pendant zur DFG - hat beschlossen, mein eingereichtes Projekt zu den
Europäischen Adressbüros in der Frühen Neuzeit (vgl hier eine
Projektbeschreibung) zu fördern. Das heißt, ich habe nun drei Jahre Zeit, daran zu recherchieren und vielleicht schaffe ich es ja auch, das Projekt in diesem Zeitraum abzuschließen. Ich plane jedenfalls, manche meiner Erkenntnisse auch in die Wikipedia einzubauen; wird sich ja zeigen, wie das klappt.
adresscomptoir -
Adressbueros - Do, 22. Mär. 2007, 08:56
Vor genau 300 Jahren, am 14.3.1707 wurde das Gründungspatent des Versatzamts, des heutigen Dorotheums, erlassen, mit dem gleichzeitig auch ein Adressbüro, das so genannte Fragamt bzw. Frag- und Kundschaftsamt gegründet wurde. Die auf diese Einrichtung bezogene Passage in dem Patent lautet wie folgt:
Schließlichen, was obangeregtes Frag-Amt anbetrifft, weilen die Erfahrniß bishero gezeiget, daß viel Partheyen verhanden, welche etwa ein Gut, Hof, Hauß, Garten, Acker, Wiesen, Weingarten, oder andere unbewegliche Güter; item, Körner, Wein, Fässer, Holtz, Heu, Pferde, Wagen, Galanterie-Waaren, Musicalische Instrumenta, wie auch Spallier, Bilder, Bibliothecken, und andere dergleichen Fahrnüsse, die ohne merklichen Unkosten und Schaden nicht auf die Märckte zu bringen seynd, zu verkauffen willens wären, jedoch aber hierum aus Mangel, daß eine solche Feilbiethung nicht kundbar ist, keinen Käufer überkommen können: herentgegen auch andere Partheyen dergleichen Stücke gern käuflich an sich bringen möchten, wann sie von ein oder anderer Feilbiethung Wissenschaft hätten; als ist nicht allein vorgemeldter Ursachen halber, sondern auch beyden Partheyen zum besten, und zwar zu Erinnerung des von denen Zubringern und Zubringerinnen bishero genommenen übermäßigen Lohns, und daß sie von jedem Gulden so gar einen Groschen ungescheut begehret haben, dieses Frag-Amt dahin eingerichtet worden: daß nicht nur auf freywilliges Anmelden eines jeden Verkäuffers, seine feilbiethende Sachen in ein eigenes darzu absonderlich haltendes Protocoll, gegen Bezahlung 17. Kreutzer Schreib-Gelds, wie er es begehrt und angiebt, eingeschrieben werden, sondern auch dem Käuffer gegen ein gleichmäßiges Aufschlag-Geld erlaubt seyn solle, das etwa verlangende Stück in gedachten Büchern nachzuschlagen, und alle Umstände zu seiner Nachricht daraus zu ersehen; mit diesem ausdrücklichen Beysatze, daß, wann nachgehends ein oder anderes hiervon verkaufft würde, man dem Amte dessentwegen weiter nichts zu reichen schuldig seyn, sondern solches nur zu dem Ende angezeigt werden solle, damit das verkauffte Stück aus dem Protocoll wiederum abgethan werden möge. Wornach sich ein jeder zu richten, auch vor Schaden zu hüten wissen wird.
Codex Austriacus, Bd.3, S.534 f.
#FragamtWien
adresscomptoir -
Adressbueros - Mi, 14. Mär. 2007, 09:11
Angelehnt vermutlich an Wilhelm von Schröders Intelligenzwerk-Projekt (vgl.
hier), schlägt Heinrich Bode in seiner 1703 veröffentlichten
Fürstlichen Macht-Kunst die Errichtung eines
Intelligenz-Hauses vor. Dies sei ein Mittel, die Manufakturen und den Kommerz zu befördern, denn dazu sei
gute Ordnung im Handel und die Intelligenz-Notitz, oder Kundschafft zweyer Personen von Nöten.
Bode nennt ein Beispiel:
Petrus wolte gern 2. Stuck Laaken oder Tuch verkauffen / Paulus 10. Stuck: Stephanus hat Tuch nöthig / weiß aber nicht wo ers bekommen soll / er weiß von Petro noch von Paulo nichts: Müssen also beyderseits Käuffer und Verkäuffer / propter ignorantiam, daß keiner weiß / wo er den andern antreffen soll / verlegen seyn.Also leydet so wohl der Fabricante und die Waare / als der Fabricante Noth und Schaden. Das zweite von Bode angeführte Beispiel lautet wie folgt:
Es will einer gern ein Koch / Schreiber / Gärtner / Diener oder Magd haben; Es lauffen dergleichen Herrn-lose Leuthe genug im Lande herumb / wollen gern einen Herrn haben / können keinen kriegen: Beyderseyts seynd daran verlegen / was machts? der Mangel der Kundschafft oder Intelligentz.
Wie läßt sich nun ein
Intelligentz-Weesen / dadurch einer vom andern Kundschafft bekommet einrichten? Bode möchte in einem
Intelligenz-Hause ein so genanntes
Ober-Intelligentz-Ambt einrichten, mit dem in den Provinzen sowie in kleinen Städten aufgestellte
Unter-Intelligentz-Aembter wöchentlich korrespondieren. Inhalt der Korrespondenz: Die eingelangten Kauf- oder Verkaufsangebote sowie die Stellengesuche und -angebote. Diese sollen
in ein Alphabetisches Protocoll eingetragen werden.
Wer nun etwas haben will / zeiget sein Verlangen entweder im Ober- oder Unter-Intelligentz-Hauß an / ist es hier nicht zu finden / welches auß dem wochentlichen gedruckten Notiz-Zettel zu ersehen / so schickt das Unter-Collegium die Desideria wochentlich ein / und erhaltet so fort auß der Notiz-Tabelle destwegen Nachricht. Diese Eintragung solle gegen die Erlegung eines
Orts-Thalers erfolgen, womit die laufenden Kosten für das
Collegium bezahlt werden könnten. - Bodes Vorschlag sieht demnach auch die Herausgabe eines Printmediums, des
wochentlichen gedruckten Notiz-Zettel vor; später wird dieses Medium die Bezeichnung Intelligenzblatt bekommen.
Bode, Heinrich: Fürstliche Macht-Kunst oder unerschöpffliche Gold-Grube, Wordurch ein Fürst sich kan mächtig und seine Unterthanen reich machen. Wien: Schönwetter, 1703, S. 130-133.
adresscomptoir -
Adressbueros - Mo, 12. Mär. 2007, 08:50
Nächste Woche - genauer: am 14. März - wird das Gründungspatent des Wiener Versatzhauses Dorotheum 300 Jahre alt und dies wird bei
Ö1 zum Anlass genommen, ein von Andreas Kloner gestaltetes Radiofeature über diese Institution auszustrahlen (Sa, 10.3., 9:05-10.00). Ein paar der Wortspenden zur Geschichte des Dorotheums stammen von mir.
adresscomptoir -
Adressbueros - Mi, 7. Mär. 2007, 09:00