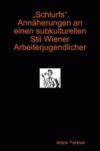Claus Bernet zitiert in der Drucklegung seiner Dissertation über die
Gebaute Apokalypse den Bericht des Meisters Heinrich Gresbeck über das Täuferreich der Münster. Damals wurden nicht nur die Stadttore, sondern auch einige Straßen umbenannt, und - so Bernet - erstmals in der Frühen Neuzeit
im deutschsprachigen Raum systematisch Straßenschilder angebracht. Die Belegstelle bei Gresbeck lautet folgendermaßen:
und hadde in ein ieder strate laten hangen ein bredeken, dair was up geschrieven, wie dat die strate heitten sol.
Bernet, Claus: "Gebaute Apokalypse". Die Utopie des Himmlischen Jerusalems in der Frühen Neuzeit. (=Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz; 215). Mainz: von Zabern, 2007, S. 108f.
Cornelius, Carl Adolf (Hg.): Berichte der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich. (=Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster; 2). Münster: Theising, 1853, S. 155f. [Bericht von Gresbeck; es gibt einen Neudruck von 1983; Digitalisat bei
Google Books]
adresscomptoir -
Communication - Do, 3. Jul. 2008, 08:41
Nicht nur in
Seoul und Addis Abeba (Läsker, Kristina: Auf dem Weg nach Irgendwo, in: Süddeutsche Zeitung, 5.1.2005, S.12) werden moderne Hausnummernsysteme eingeführt, auch in manchen Gemeinden des Zürcher Unterland ist es laut
Zürcher Unterländer soweit:
Chnübrächi, Sonnefäld oder Oberi Bleiki in Rafz, Im Sandbuck, Am Mülibach oder Im Bahnhofgarten in Dielsdorf – malerische Flurnamen sind im Unterland als Adresse gang und gäbe. Doch jetzt haben sie in der Adressfunktion ausgedient. Bis in gut einem Jahr soll jedes Gebäude, in dem Personen wohnen oder arbeiten, eine unverwechselbare Anschrift mit Hausnummer erhalten. Dies verlangt der Kanton Zürich – auch deshalb, weil im Notfall Einsatzarzt und Helfer sich mit solchen Flurnamen kaum zurechtfinden und kostbare Zeit verlieren.
(...)
Ebenso aufs neue Adressiersystem umgestellt hat Buchberg: «Da sich im Dorf früher alle kannten, genügte als Adresse der Übername», schildert Elisabeth Kahl, Gemeindeschreiberin. Denn jeder wusste, wo «de Kässeli-Guscht» wohnt.
(...)
Moderne Navigationsgeräte – wie sie heute in vielen Autos zu finden sind – funktionieren nur im Fall klarer Adressen, wozu in erster Linie konkrete Hausnummern unabdingbar sind. Gleiches gilt grundsätzlich für die Post und die Behörden; wohnt jemand an einem Ort ohne Strassennamen und Hausnummer, behilft sich die Post bis heute, indem sie eigene, inoffizielle Adressen erfindet und diese intern den Betreffenden zuteilt.
Sehr schön, ich habe das ok vom Verlag eingeholt und kann nun meinen Text über den famosen Wichtelzopf online stellen:
Tantner, Anton: Wahrheitsproduktion durch „Auskampelung“. Zum Kampf gegen den Wichtelzopf, in: Scheutz, Martin/Valeš, Vlasta (Hg.): Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2008, S. 221-233.
Bitte auch die
Verlags-Info beachten; hier nochmals das Abstract zu meinem Text:
Als direkte Folge der 1770 in Schlesien durchgeführten Seelenkonskription wird in diesem Land eine seltsam anmutende Kommission engerichtet, die die schöne Bezeichnung trägt „In Betreff der gepflogenen Untersuchung jener Personen, so mit dem sogenannten Plica Polonica, oder der Krankheit des Wichtelzopfes behaftet zu seyn angegeben worden“. Bei diesem „Wichtelzopf“ handelt es sich um eine vermeintliche Krankheit, auf die die an der „Seelenbeschreibung“ beteiligten Militär gestoßen waren, als sie im Zuge ihrer Arbeit Schlesien bereisten.
Aufgabe dieser aus Militärs, Zivilbeamten und kundigen Ärzten zusammengesetzten Kommission ist es, die „Grund-Ursachen“, die „Ursprünge“ des Übels zu erforschen sowie Heilmittel dagegen vorzuschlagen. In der Folge werden im ganzen Land die Kranken – Menschen mit „verworrenen Haaren“ – aufgesucht, manche von ihnen mit militärischer Eskorte nach Troppau überstellt. Bei der nun vorgenommenen Untersuchung wird zwischen „wahren und unächten Wichtel-Zöpfen“ unterschieden, bei ersteren seien auch die Haarwurzeln feucht, während letztere künstlich hergestellt seien, durch Einschmieren von geweihtem Öl und Wein in das Haar, mit dem Ziel, sich dadurch vor Krankheiten zu schützen. Gefunden wird der wahre Wichtelzopf nie, bei den der Kommission vorgeführten Personen läßt sich nur der „falsche“ Wichtel attestieren. Die Kommissionsmitglieder kaufen daraufhin das ihnen adäquat erscheinende Heilungsmittel an – „einige Kampel“ – und bringen es um so „begieriger“ zum Einsatz, je eher dadurch die Wahrheit über das Falsche an das Tageslicht gebracht werden kann. Sie haben Erfolg, die Krankheit wird geheilt, so manch ein Patient kann „freudenvoll nacher Haus“ zurückkehren. Das angelegte Protokoll wird nach Wien eingeschickt und im Staatsrat der Kaiserin vorgelegt, „womit also diese WichtelZopfs-Angelegenheit seine Endschaft erreichte, und die fällige Kommission geendiget wurde“.
Valentin Groebners Beitrag
Welches Thema? Welcher Text? Wissenschaftlliches Schreiben im 21. Jahrhundert (PDF), verfasst für den von Martin Gasteiner und Peter Haber herausgegebenen und für Herbst angekündigten UTB-Band
Digitale Arbeitstechniken für die Geistes- und Kulturwissenschaften ist als Preprint online. Irgendwie mit leichter Hand dahingeschrieben, mit vielen spannenden Anregungen. Nur ein Zitat daraus:
Keine claims abstecken, sondern Themen in traditionelle gelehrte Milieus injizieren. Wie Hefepilze, oder Bakterien. Das wächst dann schon.adresscomptoir -
Wissenschaft - Di, 1. Jul. 2008, 08:51
Unter der Überschrift
Besitzerstolz beschreibt
konkret in seiner aktuellen Ausgabe den folgenden Fall des Wolfgang Kraushaar:
"Der Einzige und sein Eigentum" hieß das Werk des Philosophen Max Stirner, mit dem sich Karl Marx herumzuschlagen hatte. Wie der Arsch auf den Eimer paßt der Titel anderthalb Jahrhunderte später auf den Vorgang, über den KONKRET-Autor Lars Quadfasel die Redaktion informieren durfte: Die beiden Dokumente des SDS zum Besuch israelischer Politiker, die er als Beitrag zur Serie "1968 - what's left?" hatte dokumentieren und kommentieren wollen, liegen im Privatarchiv von Reemtsmas Mittelweghistoriker Kraushaar, der ihm auf die Bitte, sie einzusehen, wie folgt geantwortet hat:
"Sehr geehrter Herr Quadfasel, tut mir leid, daß ich Sie enttäuschen muß. Aber Publikationen in einer Zeitschrift wie der von Ihnen genannten werde ich nicht unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang Kraushaar"
Der Sesselfurzer als Serenissimus. Quadfasel antwortete:
"Sehr geehrter Herr Kraushaar, vielen Dank für Ihre Antwort. Schade, daß es Ihnen nicht möglich ist, mir die Dokumente zugänglich zu machen und so den Weg zum Berliner SDS-Archiv zu ersparen. Ich weiß natürlich nicht, was zwischen Ihnen und KONKRET steht, aber Sie werden sicherlich Ihre guten Gründen haben. In meiner grenzenlosen Naivität stelle ich mir immer vor, daß es bei Fragen wie der (wissenschaftlichen und publizistischen) Kritik des linken Antizionismus vor allem um die Sache geht, und vergesse dabei regelmäßig, daß für andere sich die Prioritäten ganz anders darstellen mögen.
Mit freundlichen Grüßen, Lars Quadfasel"adresscomptoir -
HistorikerInnen - Mo, 30. Jun. 2008, 08:36
Allerdings ein hörenswerter Radiobeitrag, den Tanja Malle da für
Ö1 (Sendung Salzburger Nachtstudio, 25.6.2008, 21.01-22.00, MP3 steht im Rahmen des Ö1-Downloadabos zur Verfügung) zum Thema
Dokument der Kultur - Ort der Barbarei. Über das Verhältnis von Museum und Gewalt gestaltet hat. Anlass dafür war die gleichnamige, im Mai in Drosendorf stattgefundene
Schreibwerkstatt des Forum für Museologie und visuelle Kultur am IFF, die auch einen umfangreichen
Reader zum Thema (PDF, 30 MB) zur Verfügung stellt.
Aus der Ankündigung der Sendung:
Entgegen seinem Selbst- und Fremdbild ist das Museum "niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein", diagnostizierte der Philosoph und Gesellschaftstheoretiker Walter Benjamin. Denn Gewalt ist für die Entstehung von Museen ebenso konstitutiv wie für ihre Sammel- und Ausstellungspolitik.
So war eines der frühesten bürgerlichen Museen, der Pariser Louvre, nicht nur Nutznießer von Bilderstürmen, Revolutions- und Eroberungskriegen, sondern zugleich auch Auftraggeber für Beutekunst.
Völkerkundemuseen entstanden beispielsweise in der Folge von kolonialer Ausplünderung und Völkermord, naturhistorische und technische Museen in der Folge von sozialen Umwälzungen und der Zerstörung der Natur. Geschichts- und Heimatmuseen sind wiederum des Öfteren ein Hort aggressiver und nationalistischer Propaganda.
Bis heute noch weniger offensichtlich ist die strukturelle Gewalt der Museumspraxis: Ausstellungen dokumentieren und vermitteln Strategien der Ausgrenzung durch Auswahl und Klassifikation von Objekten und verschleiern zugleich oft deren gewalttätige Geschichten der Aneignung.adresscomptoir -
Ausstellungen - So, 29. Jun. 2008, 21:46
Für
Telepolis berichtet Bernhard Schmid über eine Revolte illegalisierter MigrantInnen in einem französischen Abschiebegefängnis und über Proteste gegen die EU-Abschieberichtlinie.
adresscomptoir -
Politik - So, 29. Jun. 2008, 11:14
Marlene Streeruwitz' Kommentar im heutigen Standard zur Koalition SPÖ-Kronenzeitung hebt sich wohltuend von den anderen ab, von denen sonst nur der von
Konrad Paul Liessmann bemerkenswert ist. Was ich bei Liessmann allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, dass er sich seine Position ex negativo von Dichand & Konsorten vorgeben lässt:
Drittens aber, und dies ist das wichtigste, garantiert diese Vorgangsweise, dass kein vernünftiger Mensch nun noch das fordern kann, was durchaus vernünftig wäre: dass über europäische Verfassungsfragen das Volk entscheiden soll. Denn niemand, der auf sich hält, will mit der Kronenzeitung, dem devoten "Brief an den Herausgeber" und der Straches Freiheitlichen in einem Atemzug genannt werden. In Europa mehr Demokratie wagen – dieses Schreckgespenst der EU-Eliten ist unter dem Vorwand, dem Volk Gehör zu verschaffen, nun endgültig diskreditiert.
Denn selbstverständlich gibt es auch andere Stimmen für eine
Volksabstimmung über den EU-Reformvertrag, die eben nicht nationalistisch/patridiotisch argumentieren; Aufgabe einer Qualitätspresse wäre es wohl, diese zu Wort kommen zu lassen.
adresscomptoir -
Politik - Sa, 28. Jun. 2008, 13:03
Sehr schön, für die
SZ porträtiert Helmut Schödel Sumpf-Macher und Schlagersänger Fritz Ostermayer. Absolut lesenswert. [via
Perlentaucher]
Kleiner, indignierter Nachtrag: Find ich echt mies, dass wegen der *#§%"$-EM der Sumpf morgen erst um 23:30 beginnt.
adresscomptoir -
Musik - Sa, 28. Jun. 2008, 10:28
Mir war er in erster Linie durch seinen schönen Aufsatz
War Making and State Making as Organized Crime bekannt, nun erfahre ich, dass Charles Tilly Ende April dieses Jahrs gestorben ist. Die
Nachrufseite verweist auf eine Vielzahl von Ressourcen und kündigt für Oktober ein Gedenksymposion an der Columbia University an; siehe auch das Posting bei
Crooked Timber. Hans-Ulrich Wehler
rezensierte jedenfalls Tillys
Die europäischen Revolutionen eher ablehnend, was wohl für die Qualität von Tillys Arbeiten spricht.
Tilly, Charles: War Making and State Making as Organized Crime, in: Evans, Peter B./Rueschemeyer, Dietrich/Skocpol, Theda (Hrsg.): Bringing the State Back In. Cambridge ua: CUP, 1985, S. 169-191. [PDF-Versionen:
1,
2]
adresscomptoir -
HistorikerInnen - Fr, 27. Jun. 2008, 08:40
Die
IG Externe LektorInnen und Freie WissenschafterInnen hat als Reaktion auf die unlängst vorgelegten Studien zur Situation der GSK in Österreich (vgl. auch die
Reaktion des FWF darauf) eine
Stellungnahme zur Verbesserung der Situation der österreichischen Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften veröffentlicht.
Update: Vgl. nun auch
Science ORF.
adresscomptoir -
Wissenschaft - Do, 26. Jun. 2008, 11:39
Und gleich noch ein Hinweis von Monochroms
Bagasch-Liste, diesmal auf eine
marxistische Analyse der Simpsons.
adresscomptoir -
Kunst - Do, 26. Jun. 2008, 08:29
Has modern life killed the semicolon? fragt Paul Collins in
Slate. Fürwahr, das wäre äußerst unerfreulich; an mir liegt's jedenfalls nicht. [via
Bagasch]
adresscomptoir -
Communication - Do, 26. Jun. 2008, 08:28
Na sowas, laut
ORF Online (sowie
das Auge) gibt's nun eine ISO-Norm mit großem scharfen ß.
adresscomptoir -
Communication - Mi, 25. Jun. 2008, 15:34
Klingt spannend:
Der Standard zur Ausstellung
nicht alles tun. Ziviler und Sozialer Ungehorsam an den Schnittstellen von Kunst, radikaler Politik und Technologie, die noch bis 18. Juli in der Galerie IG BILDENDE KUNST (Gumpendorfer Straße 10-12, 1060 Wien, Di-Fr 13-18h) sowie bis 26. Juli in
:emyt (Rosa-Luxemburg-Strasse 26, 10178 Berlin, Mi-Fr 11-18h, Sa 11-14h) zu sehen ist.
adresscomptoir -
Ausstellungen - Mi, 25. Jun. 2008, 08:53
In der Festschrift zu Karl Vocelkas 60. Geburtstag findet sich u.a. ein Artikel von Josef Pauser zu den Glückshäfen in der Frühen Neuzeit; im Hinblick auf eine Geschichte der Nummerierung ist für mich daran interessant, dass in den von Pauser genannten Fällen die ausgespielten Lose nicht nummeriert waren. Vielmehr funktionierte das Ausspielen in der Regel so, dass die verkauften Lose von den KäuferInnen mit ihrem Namen und charakteristischen Sprüchen und Wünschen beschrieben wurden und dann in einen Topf eingeworfen wurden, während in einem anderem Topf die Gewinnlose bzw. Nieten lagen. Bei der Ziehung wurde gleichzeitig aus den zwei Töpfen jeweils ein Los gezogen, was u.a. den Vorteil hatte, dass jede/r KäuferIn eines Loses einmal aufgerufen werden musste. Eine weitere Variante der Ausspielung bestand darin, dass man nach Bezahlen eines Loses selbst in den Topf (bzw. "Hafen") griff und sich einen Gewinn oder eine Niete zog. (S. 68f)
Die Identifizierung der Lose erfolgte also durch den Namen und den aufgeschriebenen Spruch; manchmal konnte es Probleme geben, wie bei einer 1564 in Wien erfolgten Ausspielung, bei der es in einem Fall eine Namensgleichheit der Loskäufer gab: Zwei Personen namens Christoph Portner, der eine ein Diener des Hofzahlmeisters Fuchs, der andere ein Einkäufer von Erzherzog Karl, hatten Lose erworben. Es war üblich, die Lose durch einen persönlichen Reim oder Spruch noch weiter zu kennzeichnen und dann in einen der Töpfe einzulegen. Eindeutiger Gewinner eines eingefassten Kleinods im Wert von 57 Gulden war der Hofzahlmeistersdiener, was durch den Spruch auch bewiesen werden konnte. Den Gewinn brachte allerdings der andere Christoph Portner an sich, und erst nach langen Verhandlungen und gegen eine Ersatzzahlung wurde der Gewinn an den richtigen Portner übergeben. (S.72f, nach WSTLA, OKAR 1565 1/98/2, fol 196v-198r).
Übrigens mussten die Veranstalter der Glückshäfen vor Ausspielung ein Verzeichnis der Gewinne erstellen; so verordnet die Glückshafenordnung von 1627, dass ain verläßliche und specificirte verzeichnus aller und jeder ihrer waaren und gewineter libell-weiß zu dem obrist spill-grafenambt in Wien zu schicken sei. (S.94). Zumindest manchmal scheint es sich dabei um ein nummeriertes Verzeichnis gehandelt zu haben, denn bei dem besagten Glückshafen von 1564 ist einmal die Rede von einem Gewinn Nr. 88, der erst 1568 an den Gewinner zugestellt werden konnte. (S.72)
-Es gibt also noch einiges zu erforschen, insbesondere wäre die Literatur zum Lottospiel nach Hinweisen zur Nummerierung von Losen durchzusehen.
Pauser, Josef: „Weil nun der Reichthum so Zuckersüß ...“ Glückshäfen in der frühneuzeitlichen Jahrmarkts- und Festkultur Österreichs, in: Scheutz, Martin/Valeš, Vlasta (Hg.): Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2008, S. 65–98.
adresscomptoir -
Nummerierung - Di, 24. Jun. 2008, 09:53