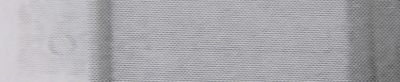Einen der ersten Versuche einer Klassifikation der unterschiedlichen Hausnummernsysteme hat um 1860 Ch. Merruau unternommen, der damit auch gleich als Begründer der vergleichenden Hausnummernforschung angesehen werden kann ;-)
Merruau unterscheidet fünf verschiedene Systeme (vgl. dazu auch meinen
Klassifikationsversuch; ich habe vier Systeme unterschieden, weil ich die strassenweise Nummerierung nicht näher aufgedröselt habe):
1.) Die ortschaftsweise Durchnummerierung, bei der den Häusern eines Dorfes oder einer Stadt eine durchgehende Serie von Nummern zugewiesen wird. Nach Merruau findet dieses System (um 1860) in Teilen Italiens sowie in Österreich, Böhmen und Polen Anwendung.
2.) Eine quartiersweise Nummerierung, wie sie in manchen Städten vorkommt (Moskau, Wien, Augsburg, Königsberg, Paris nach 1789); interessanterweise erwähnt Merruau, dass in Wien oft zwei Nummern an den Hauswänden zu finden ist, eine für das Stadtviertel und eine andere für die Stadt. Vielleicht meint er damit einfach, dass von früheren Nummerierungsepochen noch Nummern an den Wänden vorhanden sind.
3.) Die blockweise Nummerierung, bei der der einzelne Häuserblock einen oder mehrere Buchstaben zugewiesen bekommt und innerhalb des Blocks die Häuser durchnummeriert werden. Beispiele: Karlsruhe, Mannheim, Mainz
4.) Die straßenweise Nummerierung, bei der die Nummern zunächst auf einer Straßenseite entlanglaufen, und dann die andere Straßenseite zurück (London, viele englische Städte, Berlin, Dresden, München, Düsseldorf, Pest).
5.) Das französische System mit den geraden Nummern auf einer Straßenseite, den ungeraden auf der anderen. Beispiele: Teile Londons, Manchester, Glasgow, Edinburgh, US-amerikanische Städte, Belgien, viele spanische Städte, Lisabonn, Turin, Neapel, Hamburg, Frankfurt, Warschau, Stockholm, Sankt Petersburg.
Merruau, Ch.: Rapport sur la nomenclature des rues et le numérotage des maisons de Paris. Paris: Mourgues Frères, o.D. [ca. 1860], S. 47f.