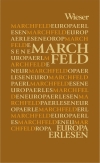Grenzflächen des Meeres
Mitte September findet im Wiener Museumsquartier im Rahmen von paraflows 07 - convention for digital arts eine von Karin Harrasser und Thomas Brandstetter konzipierte Tagung mit dem Titel Grenzflächen des Meeres statt. Ankündigung und Programm klingen vielversprechend:
:: Tagung :: Grenzflächen des Meeres ::
14.-15. September, Barocke Suiten, MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, 1070 Wien im Rahmen von paraflows 07 UN_SPACE
:: Freitag 14. September ::
i. Grenzflächen
Moderation: Günther Friesinger
10.30-11.00
Turbulenzen oder die Wissenschaften vom Kleinen
Thomas Brandstetter, Karin Harrasser
11.00-11.45
Twixt Land and Sea. Die Grenzfläche des Watts
Burkhardt Wolf
12.00-12.30
Projektpräsentation: Notes on a Coast
Ruth Anderwald und Leonhard Grond
12.30-15.00
Mittagspause
ii. Maritime Medien
Moderation: Thomas Brandstetter
15.00-15.45
Am Meeresgrund vor Helgoland. Maritime Topologien des frühen Radios
Katja Rothe
16.00-16.45
Fish & Chips. Mediale Durchmusterung von Schwärmen
Sebastian Vehlken
17.00-17.45
Unter der Wasserlinie. Mit dem österreichischen Film auf Tauchstation
Thomas Ballhausen
Ab 18.00
Filmscreening historischer Produktionen
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Samstag 15. September ::
iii. Uferlosigkeit
Moderation: Karin Harrasser
11.00-11.45
Meereslust bei Jules Verne
Roland Innerhofer
12.00-12.45
Das Meer schreiben: Die Entstehung der Ozeanographie in Wissenschaft und Roman
Robert Stockhammer
13.00-15.00
Mittagspause
iv. Seekrieg und Landfrieden
Moderation: Antonia von Schöning
15.00-15.45
(Des)Artikulationen des Meeres. Rückkopplungen zwischen Mathematik, Seekrieg und Kunst
Bernhard Siegert
16.00-16.45
Das Meer von Versailles
Tobias Nanz
17.00-17.45
Zwischen Fläche und Tiefe. Geopolitische Unterwasserwelten um 1900
Patrick Ramponi
Ab 18.00
Filmscreening historischer Produktionen
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Sonntag 16. September ::
Ab 11.00
Filmfrühstück mit Meeresfilmen im Flakturm
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Vorhaben ::
Grenzflächen des Meeres
Im letzten Kapitel von Marshall McLuhans Buch War and Peace in the Global Village wird unter dem Titel 'A Message to the Fish', die Frage verhandelt, was wir über Medien überhaupt wissen können, wenn wir davon ausgehen, dass diese - einmal installiert - eine homogene, quasi-natürliche Umwelt ausbilden, die den Menschen einschließt und kybernetisch reguliert. Für den modernen Menschen sind die technischen Medien ein ebenso natürlicher Lebensraum geworden, wie das Wasser für Fische. Nicht zufällig mutiert bei McLuhan im nächsten Schritt der Surfer zum Modellfall des Medientheoretikers: Er kennt die Gesetze des Mediums soweit er sie kennen muss, operiert aber elegant an der Wasseroberfläche.
Ein zweiter Klassiker der Medientheorie installiert die Meeresoberfläche ebenfalls als Ort des Wissens über die Medien. Eine treibende Sardinenbüchse, die in der Sonne blinkt, setzt bei Jacque Lacan eine Reflexion über den Blick in Gang. Er gelangt zur Behauptung, dass nicht nur der Beobachter die Sardinenbüchse anblicke, sondern dass diese zurückblicke. "[E]lle me regarde", heißt es im französischen Original, das die Doppeldeutigkeit von 'sie sieht mich an'/'sie geht mich etwas an' beinhält, die in der deutschen Übersetzung ('was ich sehe, sieht mich an') verlorengeht. Etwas in diesem Bild, kommt einem Verlangen entgegen, das ich nicht kenne, dessen Effekte ich bemerke, ohne dass es dem Bewusstsein zugänglich wäre. Unsere Beschäftigung mit Medien und unser Wissen über sie wird - so könnte man sagen ? durch ein Begehren nach Differenzierung und Aneignung getrieben, das sich der rationalen Beherrschung entzieht.
Wir möchten diesen beiden Gedanken folgen und daraus weitere Fragen zum Verhältnis von Wissen und Medien ableiten. Die Motivik der Begrenzungsflächen des Meeres (Wasseroberfläche, Meeresgrund, Küstenlinie, Horizont) dient dabei als Sondierungsapparat in epistemologischer wie historischer Hinsicht.
Regieren/Begrenzen
Die Metaphorik des Meeres grundiert eine spezifische Rede über elektronische Medien, die diese als diffuse, nicht weiter hierarchisch kontrollierbare 'Umwelt' ihrer Benutzer begreift. Folglich seien die elektronischen Medien für Intervention und Partizipation offener als andere Medien. Dies schließt an Deleuze/Guattaris Konzept des Meeres als einem 'glatten Raum' an, der weniger durch die Regierungsformen des Vermessens, Untergliederns, Aufteilens und Begrenzens geprägt ist als er durch Operationen des Ab- und Einschätzens und durch Intensitäten besetzt ist. Eine erste Fragerichtung wäre, ob nicht auch im Medium des Meeres klassische Herrschaftsinstrumente zum Tragen kommen und inwieweit diese durch ?navigierende? Technologien erst komplettiert werden. Ein Beispiel für eine solche Ordnung wäre das Schiff, das - obwohl nicht Teil des Rechtssystem eines Hoheitsgebietes - über eine nicht weniger strenge (formale wie informelle) Rangordnung verfügt. Das 'menschliche Strandgut', das die rezente Medienberichterstattung bevölkert, gibt einen Hinweis darauf, dass das Meer im Zeitalter globalisierter Migration mitnichten jenseits territorialstaatlicher Ordnungen existiert sondern selbst als (lebensgefährliche) Grenzfläche zwischen diesen fungiert.
Maritime Medientechniken
Unter maritimen Medientechniken sind solche zu verstehen, die sich des Meeres als Träger bedienen, z.B. das Sonar aber auch solche, die zur Beherrschung maritimer Verhältnisse entwickelt wurden (z.B. Navigationsinstrumente). Durch welche Medientechniken wird das Meer befahrbar gemacht (Navigation in der Schifffahrt, U-Boot-Technologie, Kartographie, Flugzeugträger)? Wann tritt das Meer als Hindernis medientechnischer Durchdringung auf (z.B. bei der Verlegung von Telegraphenkabeln)? Wann ist es Möglichkeitsbedingung neuer medialer Operationen?
Die Produktivkraft des Meeres
Das Meer ist nicht nur ein Gegenbild zur 'Landordnung' und sein Bedrohungsszenario, sondern wird in der Neuzeit weit über den traditionellen Fischfang hinaus wirtschaftlich produktiv gemacht: Im kolonialen Handel sind seine Unwägbarkeiten Teil des Kalküls von Mehrwert und ist seine Bemeisterung Vorbedingung für koloniale Herrschaft. Die Ingenieurswissenschaft macht darüber hinaus die Eroberung des Meeres (Deichbau) und die Nutzung der Gezeiten (Tidekraftwerke) möglich. Wie ist das Verhältnis von elementarer Bedrohung, Bezähmung und Produktivität politisch und ökonomisch gedacht worden?
Sozial- und Bewegungsformen an der Grenze
Welche Sozialformen generiert das Meer und in welchem Verhältnis stehen diese zu den Begrenzungsflächen des Meeres? Welche Kategorien werden in Hinblick auf das Meer gebildet und wie werden sie in Frage gestellt? Von Interesse sind hier Wesen, die in mehr als einem Medium leben können, bzw. Medienwechsel brauchen um zu überleben: Wale, Robben, Pinguine, fliegende Fische, Wasserläufer und Menschen wären hier zu nennen. Hinzuweisen ist aber auch darauf, dass es die Bewegungsform des Schwimmens war, die Marcel Mauss 1934 seine Überlegungen zu Körpertechniken anstellen lässt: Ausgehend vom historischen Vergleich des Schwimmtrainings (wie tief taucht der Schwimmer, hält er die Augen offen oder geschlossen) kommt er zu der Schlussfolgerung, dass Bewegungsformen habitualisierte Regierungsformen sind. Was das Meer metaphorisch für das Verhältnis von Mensch und Technik leistet, leistet das Schwimmen für die Frage nach der Internalisierung von Ordnungen.
:: Tagung :: Grenzflächen des Meeres ::
14.-15. September, Barocke Suiten, MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, 1070 Wien im Rahmen von paraflows 07 UN_SPACE
:: Freitag 14. September ::
i. Grenzflächen
Moderation: Günther Friesinger
10.30-11.00
Turbulenzen oder die Wissenschaften vom Kleinen
Thomas Brandstetter, Karin Harrasser
11.00-11.45
Twixt Land and Sea. Die Grenzfläche des Watts
Burkhardt Wolf
12.00-12.30
Projektpräsentation: Notes on a Coast
Ruth Anderwald und Leonhard Grond
12.30-15.00
Mittagspause
ii. Maritime Medien
Moderation: Thomas Brandstetter
15.00-15.45
Am Meeresgrund vor Helgoland. Maritime Topologien des frühen Radios
Katja Rothe
16.00-16.45
Fish & Chips. Mediale Durchmusterung von Schwärmen
Sebastian Vehlken
17.00-17.45
Unter der Wasserlinie. Mit dem österreichischen Film auf Tauchstation
Thomas Ballhausen
Ab 18.00
Filmscreening historischer Produktionen
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Samstag 15. September ::
iii. Uferlosigkeit
Moderation: Karin Harrasser
11.00-11.45
Meereslust bei Jules Verne
Roland Innerhofer
12.00-12.45
Das Meer schreiben: Die Entstehung der Ozeanographie in Wissenschaft und Roman
Robert Stockhammer
13.00-15.00
Mittagspause
iv. Seekrieg und Landfrieden
Moderation: Antonia von Schöning
15.00-15.45
(Des)Artikulationen des Meeres. Rückkopplungen zwischen Mathematik, Seekrieg und Kunst
Bernhard Siegert
16.00-16.45
Das Meer von Versailles
Tobias Nanz
17.00-17.45
Zwischen Fläche und Tiefe. Geopolitische Unterwasserwelten um 1900
Patrick Ramponi
Ab 18.00
Filmscreening historischer Produktionen
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Sonntag 16. September ::
Ab 11.00
Filmfrühstück mit Meeresfilmen im Flakturm
in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
:: Vorhaben ::
Grenzflächen des Meeres
Im letzten Kapitel von Marshall McLuhans Buch War and Peace in the Global Village wird unter dem Titel 'A Message to the Fish', die Frage verhandelt, was wir über Medien überhaupt wissen können, wenn wir davon ausgehen, dass diese - einmal installiert - eine homogene, quasi-natürliche Umwelt ausbilden, die den Menschen einschließt und kybernetisch reguliert. Für den modernen Menschen sind die technischen Medien ein ebenso natürlicher Lebensraum geworden, wie das Wasser für Fische. Nicht zufällig mutiert bei McLuhan im nächsten Schritt der Surfer zum Modellfall des Medientheoretikers: Er kennt die Gesetze des Mediums soweit er sie kennen muss, operiert aber elegant an der Wasseroberfläche.
Ein zweiter Klassiker der Medientheorie installiert die Meeresoberfläche ebenfalls als Ort des Wissens über die Medien. Eine treibende Sardinenbüchse, die in der Sonne blinkt, setzt bei Jacque Lacan eine Reflexion über den Blick in Gang. Er gelangt zur Behauptung, dass nicht nur der Beobachter die Sardinenbüchse anblicke, sondern dass diese zurückblicke. "[E]lle me regarde", heißt es im französischen Original, das die Doppeldeutigkeit von 'sie sieht mich an'/'sie geht mich etwas an' beinhält, die in der deutschen Übersetzung ('was ich sehe, sieht mich an') verlorengeht. Etwas in diesem Bild, kommt einem Verlangen entgegen, das ich nicht kenne, dessen Effekte ich bemerke, ohne dass es dem Bewusstsein zugänglich wäre. Unsere Beschäftigung mit Medien und unser Wissen über sie wird - so könnte man sagen ? durch ein Begehren nach Differenzierung und Aneignung getrieben, das sich der rationalen Beherrschung entzieht.
Wir möchten diesen beiden Gedanken folgen und daraus weitere Fragen zum Verhältnis von Wissen und Medien ableiten. Die Motivik der Begrenzungsflächen des Meeres (Wasseroberfläche, Meeresgrund, Küstenlinie, Horizont) dient dabei als Sondierungsapparat in epistemologischer wie historischer Hinsicht.
Regieren/Begrenzen
Die Metaphorik des Meeres grundiert eine spezifische Rede über elektronische Medien, die diese als diffuse, nicht weiter hierarchisch kontrollierbare 'Umwelt' ihrer Benutzer begreift. Folglich seien die elektronischen Medien für Intervention und Partizipation offener als andere Medien. Dies schließt an Deleuze/Guattaris Konzept des Meeres als einem 'glatten Raum' an, der weniger durch die Regierungsformen des Vermessens, Untergliederns, Aufteilens und Begrenzens geprägt ist als er durch Operationen des Ab- und Einschätzens und durch Intensitäten besetzt ist. Eine erste Fragerichtung wäre, ob nicht auch im Medium des Meeres klassische Herrschaftsinstrumente zum Tragen kommen und inwieweit diese durch ?navigierende? Technologien erst komplettiert werden. Ein Beispiel für eine solche Ordnung wäre das Schiff, das - obwohl nicht Teil des Rechtssystem eines Hoheitsgebietes - über eine nicht weniger strenge (formale wie informelle) Rangordnung verfügt. Das 'menschliche Strandgut', das die rezente Medienberichterstattung bevölkert, gibt einen Hinweis darauf, dass das Meer im Zeitalter globalisierter Migration mitnichten jenseits territorialstaatlicher Ordnungen existiert sondern selbst als (lebensgefährliche) Grenzfläche zwischen diesen fungiert.
Maritime Medientechniken
Unter maritimen Medientechniken sind solche zu verstehen, die sich des Meeres als Träger bedienen, z.B. das Sonar aber auch solche, die zur Beherrschung maritimer Verhältnisse entwickelt wurden (z.B. Navigationsinstrumente). Durch welche Medientechniken wird das Meer befahrbar gemacht (Navigation in der Schifffahrt, U-Boot-Technologie, Kartographie, Flugzeugträger)? Wann tritt das Meer als Hindernis medientechnischer Durchdringung auf (z.B. bei der Verlegung von Telegraphenkabeln)? Wann ist es Möglichkeitsbedingung neuer medialer Operationen?
Die Produktivkraft des Meeres
Das Meer ist nicht nur ein Gegenbild zur 'Landordnung' und sein Bedrohungsszenario, sondern wird in der Neuzeit weit über den traditionellen Fischfang hinaus wirtschaftlich produktiv gemacht: Im kolonialen Handel sind seine Unwägbarkeiten Teil des Kalküls von Mehrwert und ist seine Bemeisterung Vorbedingung für koloniale Herrschaft. Die Ingenieurswissenschaft macht darüber hinaus die Eroberung des Meeres (Deichbau) und die Nutzung der Gezeiten (Tidekraftwerke) möglich. Wie ist das Verhältnis von elementarer Bedrohung, Bezähmung und Produktivität politisch und ökonomisch gedacht worden?
Sozial- und Bewegungsformen an der Grenze
Welche Sozialformen generiert das Meer und in welchem Verhältnis stehen diese zu den Begrenzungsflächen des Meeres? Welche Kategorien werden in Hinblick auf das Meer gebildet und wie werden sie in Frage gestellt? Von Interesse sind hier Wesen, die in mehr als einem Medium leben können, bzw. Medienwechsel brauchen um zu überleben: Wale, Robben, Pinguine, fliegende Fische, Wasserläufer und Menschen wären hier zu nennen. Hinzuweisen ist aber auch darauf, dass es die Bewegungsform des Schwimmens war, die Marcel Mauss 1934 seine Überlegungen zu Körpertechniken anstellen lässt: Ausgehend vom historischen Vergleich des Schwimmtrainings (wie tief taucht der Schwimmer, hält er die Augen offen oder geschlossen) kommt er zu der Schlussfolgerung, dass Bewegungsformen habitualisierte Regierungsformen sind. Was das Meer metaphorisch für das Verhältnis von Mensch und Technik leistet, leistet das Schwimmen für die Frage nach der Internalisierung von Ordnungen.
adresscomptoir -
Veranstaltungen - Do, 30. Aug. 2007, 09:10