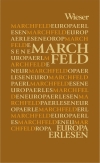Die Zeit bringt einen Vorabdruck aus der deutschen Übersetzung eines
hier bereits angezeigten Buchs über die Geschichte von Google; der Verlag hat auch eine eigene Homepage -
http://www.diegooglestory.de - zum Buch eingerichtet.
Vise, David/Malseed, Mark: Die Google Story. Hamburg: Murmann Verlag, erscheint Mitte März 2006.
In einem Interview mit der
Jungle World moniert Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, dass sich verhältnismäßig wenige GeisteswissenschafterInnen an der Online-Enzyklopädie beteiligen. Kommt schon noch, denke ich mir. Wie wär's denn überhaupt mit der Idee, dass die Vergabe von Projektgeldern in Zukunft an die Bedingung geknüpft wird, zumindest Teile der Ergebnisse auch in der Wikipedia zu veröffentlichen?
Klingt ja bestechend, Klaus Grafs auf
netbib angezeigter Selbstversuch: Man bestelle bei der KB Den Haag einen Benutzerausweis und bekomme damit vom Home-PC aus Zugriff auf eine Reihe wichtiger Datenbanken und Zeitschriftenangebote, wie Historical Abstracts, JSTOR, MUSE usw. Wow!
H-SOZ-U-KULT bringt eine Rezension eines anscheinend etwas pessimistisch daherkommenden, nichtsdesotrotz aber verheissungsvoll klingenden Sammelbands:
Epple, Angelika/Haber, Peter (Hg.): Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Version 1.0. Zürich: Chronos, 2005.
Dank der Arbeit von
Peter Haber und
Jan Hodel ist nun das
Submodul Literaturrecherche des E-Learningangebots
Geschichte Online "helvetisiert", d.h. es werden auch die Schweiz betreffende Bibliothekskataloge und Datenbanken vorgestellt.
Eine Jobausschreibung von der Homepage der
Österreichischen Nationalbibliothek:
Langzeitarchivierung digitaler Medien
Für das Team Digitale Medien in der Hauptabteilung Bestandsaufbau und Bearbeitung suchen wir zum Eintritt per 1. April 2006 eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter(in).
Das Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen:
- Anpassung und Optimierung der Software unseres Digitalen Archivs.
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und technischen Strategien im Bereich digitaler Archivierung.
- Mitarbeit bei EU-Projekten im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung.
- Technische Katalogisierung: Prüfung abgelieferter digitaler Objekte auf Konsistenz und Vollständigkeit und Formalerfassung von digitalen Objekten.
Wir erwarten von Ihnen Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Datenbanksystemen (Oracle), sehr gute Kenntnisse von Unix/Linux und XML-Technologien, idealerweise Programmierkenntnisse in Perl und XSLT, sehr gute Englischkenntnisse und Erfahrung in projektorientiertem Arbeiten. Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Interesse am Bibliothekswesen setzen wir voraus.
Wir erwarten eine/n belastbare/n, teamfähige/n Mitarbeiter/in mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und der unbedingten Bereitschaft, sich neue Kenntnisse und Technologien anzueignen.
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen schriftlichen Unterlagen bis 28. Februar 2006 an die Österreichische Nationalbibliothek, Personalabteilung z.Hd. Frau Steindl, Josefsplatz 1, 1015 Wien.
5 Jahre gibt es sie nun schon, die Wikipedia, und in
Telepolis wird dies zum Anlass genommen, fünf Herausforderungen für die Zukunft zu skizzieren.
Eine recht instruktive Beschreibung der Funktionsweise von Google bringt
Google's Newsletter for Librarians. [via
netbbib]
Mittlerweile gibt es übrigens zwei interessant klingende Neuerscheinungen zu Google:
Vise, David/Malseed, Mark: The Google Story. New York: Delacorte Press, 2005. [
Amazon]
Battelle, John: The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture. New York: Portfolio, 2005. [
Amazon]
Clio online stellt nun regionale Übersichten zur Geschichtswissenschaft vor, darunter einen
Online Guide durch die Geschichtswissenschaften Österreichs, erstellt von Martin Gasteiner und Christian Pape. Vorgestellt werden u.a. die Angebote der Österreichischen Nationalbibliothek, das in Innsbruck ansässige Zeitgeschichtsinformationssystem sowie das Wiener Institut für Geschichte.
Einen Plan eines Zeitungsindex - quasi einen Vorläufer des Dietrich - präsentiert Dostojewskij in seinem 1871/1873 erschienenen Roman Böse Geister. Darin präsentiert die Protagonistin Lisaweta Nikolajewna dem Studenten Schatow folgendes Anliegen:
Das literarische Unternehmen sollte folgender Art sein: In Rußland erscheint, in den Metropolen und in der Provinz, eine Unzahl von Lokalzeitungen und anderen Journalen, in denen Tag für Tag über eine Unzahl von Ereignissen berichtet wird. Das Jahr verstreicht, die Blätter werden allerorts in Schränken gestapelt oder fliegen herum, werden zerrissen, als Packpapier gebraucht und zu Papiermützen gefaltet. Viele veröffentlichte Fakten machen Eindruck und bleiben im Gedächtnis des Lesers haften, entschwinden ihm aber im Laufe der Jahre. Später möchten viele Leser sich wieder informieren, aber welche Mühe kostet es dann, sich in diesem Blättermeer zurechtzufinden, häufig ohne Tag, Ort und sogar Jahr des betreffenden Ereignisses zu kennen! Würde man indessen die Fakten eines ganzen Jahres in einem Band zusammenstellen, nach bestimmtem Plan und unter bestimmten Gesichtspunkten, mit Inhaltsverzeichnis, Register, Chronologie, so könnte eine solche Synopse das russische Leben eines ganzen Jahres umfassend charakterisieren, auch wenn die veröffentlichten Fakten nur einen ganz geringen Teil des Gesamtgeschehens darstellten.
»Statt einer Unzahl von Blättern hätte man einige dicke Bände, und das wäre alles«, bemerkte Schatow.
Aber Lisaweta Nikolajewna verfocht ihren Plan mit glühendem Eifer, auch wenn es ihr nicht leicht fiel und sie Mühe hatte, sich richtig auszudrücken. Es müsse ein Band sein, sogar kein besonders dicker - meinte sie. Und selbst angenommen, es sei ein dicker, so doch ein klarer, denn alles komme auf den Gesamtplan und die Art der Darstellung an. Selbstverständlich müsse nicht alles gesammelt und nachgedruckt werden. Auf Ukasse, Regierungsmaßnahmen, Regionalverfügungen, Gesetze, alles äußerst wichtige Dinge, könne man trotzdem in dem geplanten Werk völlig verzichten. Man könne durchaus auf vieles verzichten und sich auf eine Auswahl beschränken, die mehr oder weniger das sittliche, persönliche Leben des Volkes widerspiegele, die Persönlichkeit des russischen Volkes in einem bestimmten Augenblick. Selbstverständlich könne alles aufgenommen werden: Kurioses, Feuersbrünste, Spenden, alle möglichen guten und bösen Werke, alle möglichen Aussprüche und Reden, vielleicht sogar Berichte über Hochwasser, vielleicht sogar auch bestimmte Regierungsukasse, aber immer nur in einer Auswahl, die die Epoche charakterisiere; alles solle unter einem bestimmten Gesichtspunkt gesehen werden, einen Hinweis, eine Absicht, eine das Ganze, die Gesamtheit erhellende Idee enthalten. Und schließlich müsse das Buch sogar für eine unterhaltsame Lektüre geeignet sein, von seiner Unentbehrlichkeit als Nachschlagewerk ganz abgesehen! Es solle sozusagen ein Tableau des geistigen, sittlichen, inneren russischen Lebens während eines ganzen Jahres bieten. »Es muß so sein, daß alle es kaufen. Es muß so sein, daß dieser Band zu einem Handbuch wird«, sagte Lisa zum Schluß.
Dostojewskij, Fjodor: Böse Geister. Frankfurt am Main: Fischer 14658, 2000, S. 167-169.